Startseite » Über uns » Preisauszeichnungen » Förderoffensive
Förderoffensive
Mit der Förderoffensive hat die Stiftung Universitätsmedizin eine Million Euro zusätzlich für Innovationen im Bereich Organspende und interdisziplinäre Projekte ausgelobt. Aus den zahlreichen Einreichungen wählte eine Fachjury 15 besonders vielversprechende Vorhaben aus. Sie beweisen die hohe Qualität des Forschungsstandorts Essen.
Die Verbesserung der Krankenversorgung über die Grundversorgung hinaus ist das Ziel, für das die Stiftung Universitätsmedizin am meisten Aufmerksamkeit erfährt. Die Förderung der Forschung zählt allerdings ebenso zu den Aufgaben, die fest in der Satzung verankert sind. So konnte die Stiftung In der Vergangenheit über Anschub- und Teilfinanzierungen bereits häufig Forschungsprojekte erst möglich machen. Die Förderoffensive soll eine Initialzündung geben, weitere innovative Ideen Realität werden zu lassen
Die geförderten Projekte
Warnsignal im Gewebe – Abstoßung nach Herztransplantation früher erkennen
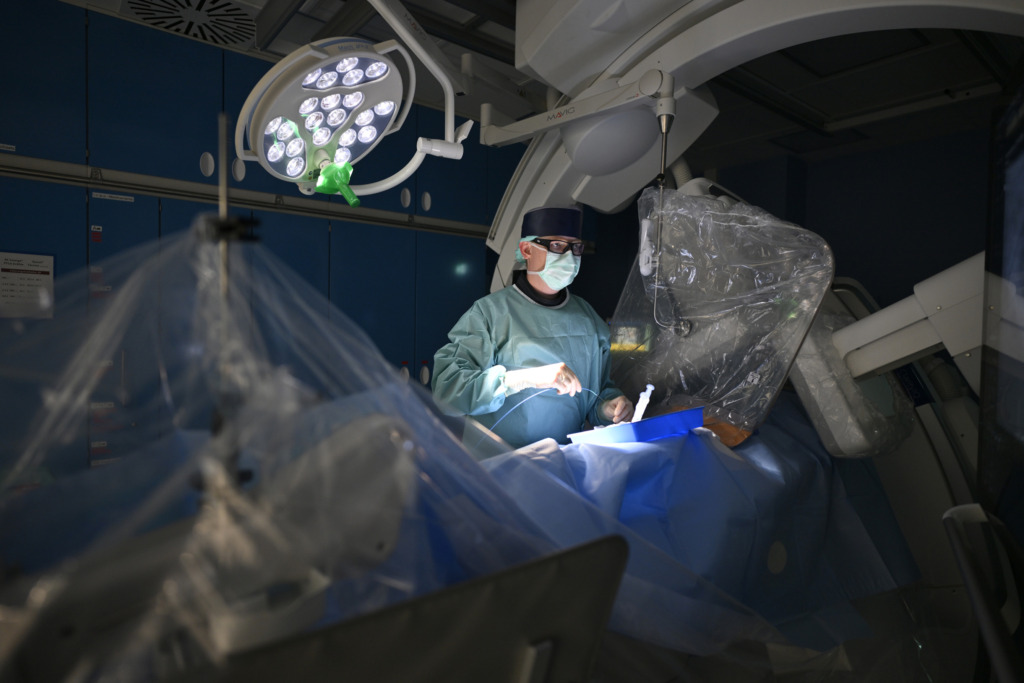
Eine Herztransplantation kann Leben retten – doch noch immer zählt die Abstoßung des Spenderorgans zu den größten Risiken. Aktuell wird diese oft erst entdeckt, wenn bereits schwere Gewebeschäden entstanden sind. „Das Projekt untersucht den Rezeptor PD-L1, der möglicherweise schon früh Veränderungen im transplantierten Herzgewebe signalisiert“, erklärt Privatdozent Dr. Lars Michel, bereichsleitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie und Mitglied des Westdeutschen Zentrums für Organtransplantation der Universitätsmedizin Essen. In Kooperation mit der Kardiopathologie des Universitätsklinikums Tübingen durchführt sollen an Hand von Gewebeproben und innovativen Einzelzellanalysen Muster identifiziert werden, die auf eine drohende Abstoßung hinweisen. Eine solche systematische Analyse mit Einzelzellansatz wird erstmals durchgeführt. Die Erkenntnisse des Forschungsprojekts könnten künftig eine präzisere Überwachung ermöglichen – und die Chance erhöhen, rechtzeitig gegenzusteuern. Das Ziel: bessere Langzeitergebnisse und mehr Sicherheit für Herztransplantierte.
Spenderlungen besser nutzen: Reparatur und Prüfung durch maschinelle Perfusion

In Deutschland gibt es nicht nur zu wenige Spenderorgane – oft werden potenzielle Spenderlungen auch nicht genutzt, weil ihre Qualität schwer einzuschätzen ist. „Mit unserem Forschungsprojekt möchten wir das ändern“, erklärt Prof. Dr. Markus Kamler von der Abteilung Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie der Universitätsmedizin Essen.Mithilfe der sogenannten maschinellen Perfusion (MP) können Lungen außerhalb des Körpers mit Flüssigkeit durchspült und beatmet werden, um ihre Funktion zu prüfen oder sogar zu verbessern. Prof. Kamler: „So könnten auch grenzwertige oder geschädigte Lungen für Transplantationen genutzt werden.“ Besonders innovativ ist dabei der Einsatz künstlicher Sauerstoffträger (Perfluorcarbone), die eine bessere Versorgung des Gewebes ermöglichen als herkömmliche Lösungen. Das Projekt wird im Schweinemodell erprobt und untersucht dabei unter anderem die Durchblutung, Entzündungswerte und die Funktion der Zellkraftwerke (Mitochondrien). Ziel ist es, die Methode bald auch bei menschlichen Lungen anzuwenden. So könnten mehr Organe gerettet und Wartelisten verkürzt werden.
Abstoßung verhindern: Immunreaktionen nach Nierentransplantation gezielt erforschen

Die Nierentransplantation ist lebensrettend und die Hoffnung für jeden Dialysepatienten – doch es fehlen passende Spenderorgane. Ein Problem dabei ist, dass viele Nieren nach der Entnahme nicht sofort richtig funktionieren oder später vom Immunsystem abgestoßen werden. Ein möglicher Grund: Während der Lagerung und Vorbereitung der Niere werden bestimmte Botenstoffe im Organ aktiviert, sogenannte Typ-I-Interferone, die eine Entzündungsreaktion auslösen. „Mit unserem Forschungsprojekt untersuchen wir, wie genau diese Interferone entstehen, welche Signalwege beteiligt sind und wie sich ihre Wirkung auf das Transplantat auswirkt“, erklären Prof. Dr. Karl Lang vom Institut für Immunologie und Prof. Dr. Benjamin Wilde von der Klinik für Nephrologie der Universitätsmedizin Essen. Dazu werden Nieren aus Mäusen und Ratten untersucht – sowohl im Labor als auch in einem Transplantationsmodell. Ziel ist es, die Immunreaktion direkt nach der Spende besser zu verstehen und neue Wege zu finden, um sie gezielt zu beeinflussen. Langfristig könnte das helfen, die Funktion von Spendernieren zu verbessern und mehr Transplantationen erfolgreich durchzuführen.
Gerechter und erfolgreicher: Künstliche Intelligenz soll die Vergabe von Spenderlebern verbessern

Bei der Vergabe von Spenderlebern in Deutschland wird aktuell nur die Dringlichkeit der Transplantation berücksichtigt – nicht aber die Erfolgsaussichten. Das Forschungsprojekt von Prof. Dr. Lale Umutlu vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie der Universitätsmedizin Essen möchte mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ein neues Bewertungssystem entwickeln, das zusätzlich auch die individuellen Erfolgschancen berücksichtigt. Prof. Umutlu: „Ziel ist ein KI-basiertes Scoring-Modell, das die Risiko-Nutzen-Abwägung bei der Organverteilung verbessert und dadurch langfristig mehr Leben rettet.“ Dafür werden medizinische Daten großer Patientengruppen analysiert, zum Beispiel zu Alter, Begleiterkrankungen oder Gewebeeigenschaften. In das Projekt sind Kooperationspartner aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationsmedizin sowie des Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) eingebunden. Die Forschenden kombinieren somit Expertise aus Transplantationsmedizin, Radiologie und KI-Forschung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erkennung neuer Biomarker, die auf den zu erwartenden Therapieerfolg hinweisen könnten. So soll die Entscheidung über Organvergabe nicht nur gerechter, sondern auch medizinisch fundierter werden. Das Projekt legt die Grundlage für eine präzisere, personalisierte Vergabe von Spenderorganen in der Zukunft.
Organe schützen: Wie Zellkraftwerke bei Kälte erhalten bleiben können
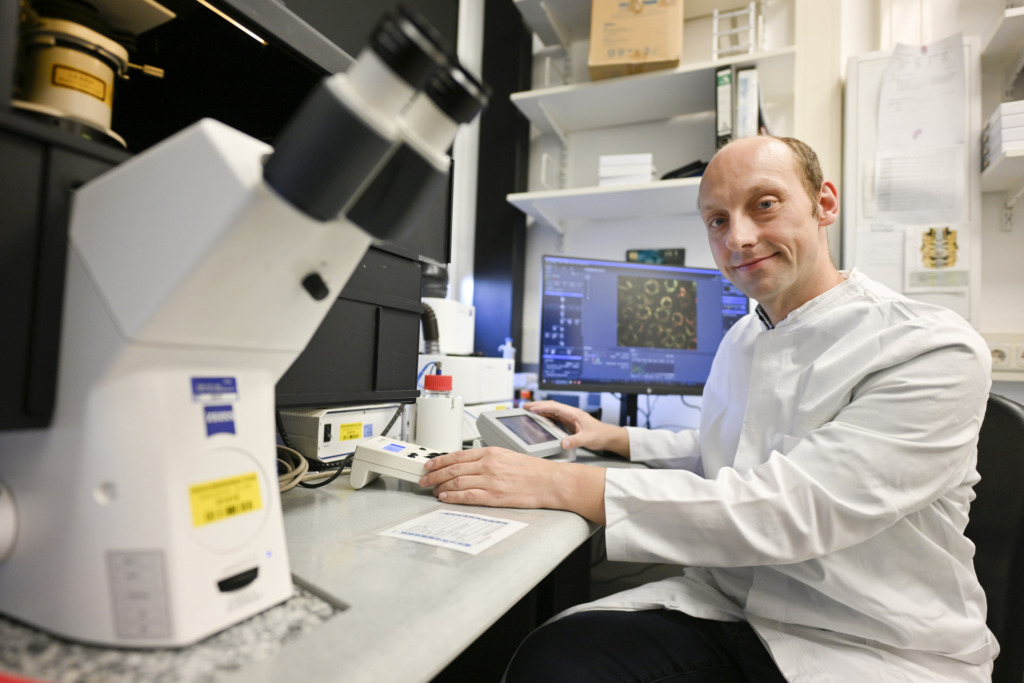
Ein zentrales Problem in der Transplantationsmedizin ist, dass Organe während der Lagerung vor der Transplantation Schaden nehmen – besonders die „Kraftwerke der Zelle“, die Mitochondrien, sind davon betroffen. „Das Forschungsprojekt untersucht, wie genau sich Kaltlagerung und anschließende Wiedererwärmung auf die Ultrastruktur der Mitochondrien und dabei insbesondere auf die Einstülpungen der inneren Membran, den sogenannten Cristae, auswirken“, erklärt Dr. Björn Walter vom Institut für Physiologische Chemie der Universitätsmedizin Essen. „Diese Strukturen sind entscheidend für die Energieproduktion in Zellen und verändern sich unter Kälteeinfluss.“ Ziel ist es, die zugrundeliegenden Mechanismen besser zu verstehen, um gezielt Schutzmaßnahmen entwickeln zu können, die die Mitochondrienfunktion und damit die Organqualität erhalten. Dafür werden Versuche mit menschlichen Nierenzellen sowie mit Rattennieren durchgeführt. Analysiert werden dabei bestimmte Eiweiße (MICOS-Komplex), die für den Erhalt der Cristae-Struktur verantwortlich sind.
Mehr Lebern retten: Neue Perfusionslösung erstmals im Test an menschlichen Lebern

In der Transplantationsmedizin fehlen oft gesunde Spenderorgane, besonders bei Lebern. Um auch grenzwertige Organe besser nutzen zu können, wird im Projekt eine neue Perfusionslösung mit künstlichem Sauerstoffträger entwickelt und getestet. „Diese Lösung soll es ermöglichen, Organe länger außerhalb des Körpers zu versorgen und dabei ihre Qualität zu erhalten oder sogar zu verbessern“, erklären Prof. Dr. Arzu Özcelik von der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie und Prof. Dr. Katja Siebecke vom Institut für Physiologie der Universitätsmedizin Essen, die das Projekt in Kooperation leiten. Ziel ist es, geschädigte Lebern besser vorzubereiten, bevor sie transplantiert werden, um so die Erfolgsrate der Operationen zu erhöhen. In einem ersten Schritt wird die neue Lösung an Lebern erprobt, die nicht für eine Transplantation vorgesehen sind. Untersucht werden unter anderem die Leberfunktion, Entzündungswerte und mögliche Zellschäden. Wenn sich die Methode bewährt, könnte sie helfen, mehr Organe zu retten, die bisher unbrauchbar wären – und so Leben auf den Wartelisten retten. Gleichzeitig würde sie Transplantationen planbarer und medizinisch sicherer machen.
Stark durch den Wechsel: Jugendliche sicher aus der Kinder- und Jugendmedizin in die Erwachsenen-medizin begleiten

Dank medizinischem Fortschritt erreichen immer mehr Kinder mit schweren Erkrankungen das Erwachsenenalter – auch nach Organtransplantationen. Der Übergang von der Kinder- und Jugendmedizin zur Erwachsenenmedizin (Transition) ist dabei jedoch oft nicht ausreichend mit den Patienten, Eltern und den Behandlungsteams der jeweiligen Kliniken koordiniert, was zu einem erhöhten Risiko für Organverlust bei jungen Erwachsenen führt. „Unser Projekt entwickelt ein strukturiertes, digitales Begleitprogramm, das diese Situation verbessern soll“, erklärt Monja Gerigk vom Institut für Patientenerleben der Universitätsmedizin Essen. Das Begleitprogramm namens Ready Steady Go soll Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren helfen, den Wechsel in die Erwachsenenmedizin gut vorbereitet zu meistern. Geschulte Fallmanager:innen begleiten die Jugendlichen und ihre Eltern bei medizinischen, sozialen und alltagsbezogenen Fragen. Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz der Jugendlichen zu stärken und die Funktion ihrer transplantierten Organe langfristig zu erhalten. Eine digitale Plattform soll zusätzlich Informationen, Schulungsvideos und einen sicheren Austausch mit dem medizinischen Team ermöglichen. Das Projekt ist deutschlandweit einzigartig und könnte langfristig auch für andere chronische Kinderkrankheiten übernommen werden.
Was macht Pornokonsum mit uns? Körperliche und hormonelle Reaktionen im Fokus

Fast ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland nutzt regelmäßig Pornografie – die Auswirkungen auf das Sexualleben sind jedoch nicht gut erforscht. Besonders diskutiert wird die sogenannte eventuelle „Desensibilisierung“, bei der sich der Körper an sexuelle Reize gewöhnen und weniger stark darauf reagieren könnte. „Das geplante Forschungsprojekt untersucht, wie sich vermehrter oder reduzierter Pornokonsum auf Sexualhormone, Erregung und körperliche Reaktionen auswirkt“, erklären Dr. Mónika Koós und Dana Huvermann, die das Vorhaben am Lehrstuhl von Prof. Dr. Johannes Fuß vom Institut für Forensische Psychiatrie und Sexualforschung der LVR-Universitätsklinik Essen betreuen. In drei Phasen dokumentieren die Teilnehmenden ihren Konsum per App, geben Speichelproben ab und werden im Labor auf physiologische Reaktionen beim Ansehen sexueller Reize getestet. In der zweiten Phase sollen zwei Gruppen einen Monat lang entweder mehr oder gar keine Pornografie konsumieren. Ziel ist es, herauszufinden, ob Abstinenz oder Steigerung des Konsums messbare körperliche und hormonelle Veränderungen bewirkt. Die Ergebnisse sollen helfen, besser zu verstehen, wie problematischer Pornokonsum wirkt – und ob vollständiger Verzicht sinnvoll ist. Das Projekt vereint psychologische, soziale und biologische Perspektiven und schafft eine Grundlage für spätere, größere Studien.
Therapie neu denken: Mit Virtual Reality aus der Magersucht entkommen

Anorexia nervosa – umgangssprachlich Magersucht – ist eine ernste Essstörung, die vor allem junge Menschen betrifft und schwer zu behandeln ist. Besonders während der Corona-Pandemie ist die Zahl schwerer Erkrankungsfälle deutlich gestiegen. Das Forschungsprojekt der LVR-Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kinder- und Jugendalters untersucht in Kooperation mit Prof. Dr. Maic Masuch von der Fakultät für Informatik der Universität Duisburg-Essen das Potenzial von Virtual Reality (VR) für neue Therapieformen. „Ein sogenannter ‚Escape Room‘ in der virtuellen Welt soll helfen, gedankliche und emotionale Muster, die mit der Erkrankung zusammenhängen, zu erkennen und zu verändern“, erklärt Projektleiterin Privatdozentin Dr. Gertraud Gradl-Dietsch. Patient:innen erleben in der virtuellen Welt spielerisch herausfordernde Situationen, in denen sie zum Beispiel gesunde Entscheidungen treffen oder mit Stress umgehen lernen. Ziel ist es, Selbstvertrauen und Motivation zu stärken und die Rückkehr in den Alltag zu erleichtern. Auch Angehörige sollen eingebunden werden, um die Krankheit besser zu verstehen. Das Projekt will neue Erkenntnisse für wirksame Behandlungsformen liefern und könnte langfristig die Therapie von Essstörungen verbessern.
Immunabwehr stärken: Wie körpereigene Killerzellen Viren nach Transplantation kontrollieren
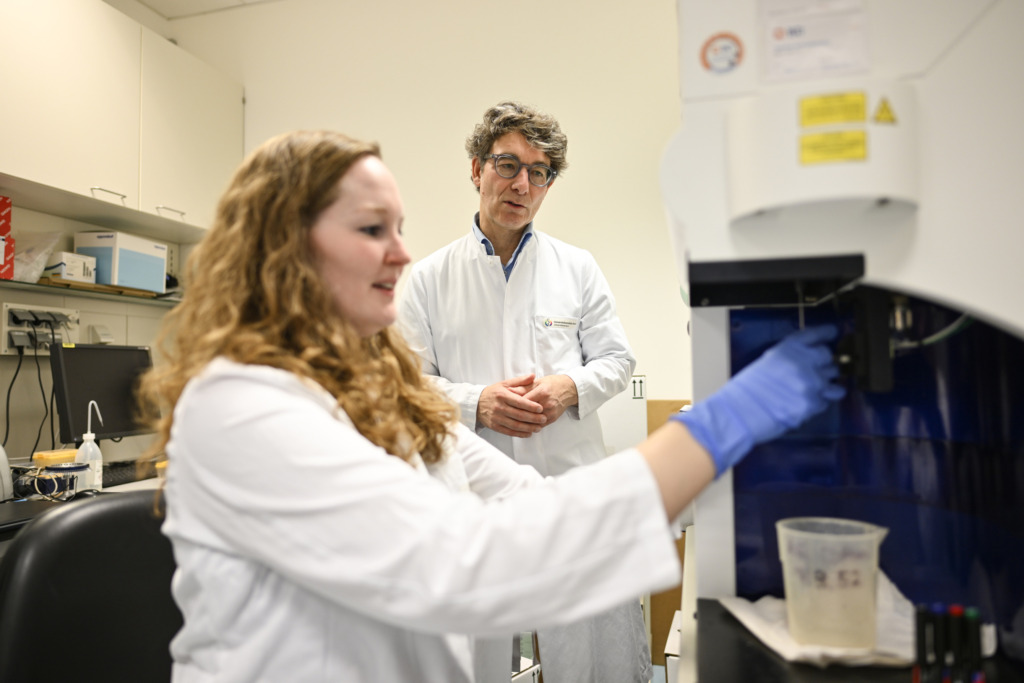
Bei der Behandlung von Leukämien ist eine Stammzelltransplantation oft die einzige Heilungschance – doch das Immunsystem ist danach stark geschwächt. Besonders gefährlich sind Reaktivierungen des Cytomegalovirus (CMV), die bei etwa 30 Prozent der Betroffenen auftreten. In dieser frühen Phase nach der Transplantation fehlen meist noch schützende T-Zellen, während sogenannte Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) bereits vorhanden sind – sie könnten daher eine wichtige Rolle bei der Abwehr spielen. Das Medikament Letermovir wird vorbeugend gegen CMV eingesetzt, könnte aber die Entwicklung dieser wichtigen NK-Zellen behindern. „Unser Projekt untersucht, wie sich NK-Zellen nach der Transplantation unter Letermovir-Therapie entwickeln – und ob ihre Fähigkeit zur Virusabwehr oder zur Kontrolle der Leukämie dadurch beeinflusst wird“, erklärt Prof. Dr. Sebastian Voigt vom Institut für Virologie der Universitätsmedizin Essen. Dazu werden Blutproben transplantierter Patient:innen mit und ohne Letermovir-Gabe verglichen. Ziel ist es, die antivirale Therapie besser auf die Immunlage der Patient:innen abzustimmen und langfristig bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen.
Genveränderungen im Fokus: Vielversprechender Ansatz für Patient:innen mit unklarer Ataxie-Diagnose
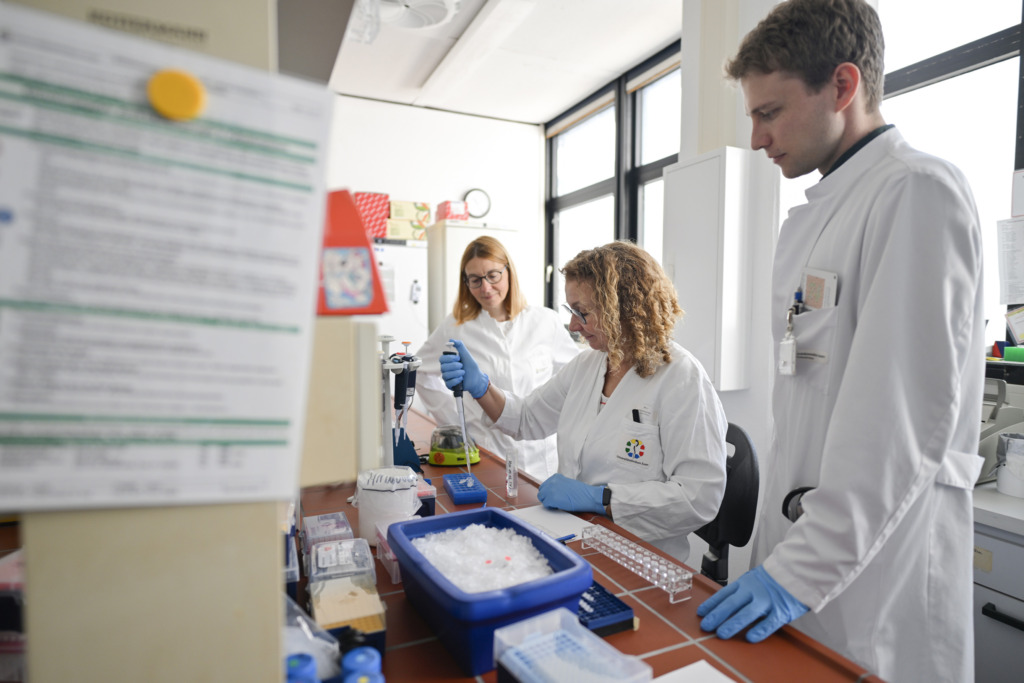
Zerebellare Ataxien sind seltene, oft genetisch bedingte Erkrankungen, die das Kleinhirn betreffen und zu Koordinations-, Sprech- und Schluckstörungen führen können. Trotz moderner genetischer Tests bleibt bei vielen Betroffenen die genaue Ursache unbekannt. „Unser Projekt untersucht nun gezielt eine mögliche neue Ursache: Veränderungen in sogenannten snRNA-Genen, die für die richtige Verarbeitung genetischer Informationen in der Zelle wichtig sind“, erklären Prof. Dr. Christel Depienne vom Institut für Humangenetik der Universitätsmedizin Essen und Dr. Friedrich Erdlenbruch von der Klinik für Neurologie. Mithilfe einer speziellen Sequenzierungsmethode sollen diese schwer zugänglichen Erbgutabschnitte bei 100 Patient:innen analysiert werden, bei denen bisher keine Diagnose gefunden wurde. Ziel ist es, bislang verborgene genetische Auslöser der Ataxien zu entdecken. Bei auffälligen Befunden sollen weitere Labortests zeigen, ob die genetischen Veränderungen tatsächlich die Krankheit verursachen können. Das Projekt könnte die Diagnostik für Ataxie-Patient:innen deutlich verbessern – und langfristig potenziell neue Therapien ermöglichen. Es ist an der Universitätsmedizin Essen angesiedelt und nutzt die enge Zusammenarbeit von Neurologie, Genetik und Bioinformatik.
Zurück ins Leben: Bewegungstherapie für Krebspatient:innen nach Stammzelltransplantation

Nach einer Stammzelltransplantation leiden viele Patient:innen unter körperlicher Schwäche und Problemen bei der Rückkehr in den Alltag – besonders ältere Menschen. „Das Forschungsprojekt RESTART untersucht, wie gezieltes Bewegungstraining nach der stationären Behandlung dabei helfen kann, körperliche Fitness, Selbstständigkeit und soziale Teilhabe zu verbessern“, erläutert Privatdozentin Dr. Miriam Götte, die das Projekt im Bereich Exercise Oncology des Westdeutschen Tumorzentrums (WTZ) der Universitätsmedizin Essen betreut. In der Studie erhält die Hälfte der Patient:innen direkt nach der Transplantation über zwölf Wochen hinweg eine strukturierte Trainingstherapie. Die andere Hälfte erhält als Vergleich nur die übliche Versorgung – mit der Möglichkeit, im Anschluss an die zwölf Wochen ebenfalls an der Bewegungstherapie teilzunehmen. Zusätzlich wird auch die körperliche Verfassung vor der Transplantation erfasst, um herauszufinden, ob sie den späteren Behandlungserfolg beeinflusst. Ziel ist es, festzustellen, welche Patientengruppen besonders vom Training profitieren. Die Studie verknüpft Sportmedizin und Krebsmedizin und baut auf bereits etablierten Bewegungsangeboten auf. Langfristig könnte sie dazu beitragen, Bewegungstherapie als festen Bestandteil in der Krebsnachsorge zu verankern.
Warum Leukämie nach Transplantation wiederkommt – und was man dagegen tun kann

Die akute myeloische Leukämie (AML) ist eine aggressive Krebserkrankung, die häufig nur durch eine Stammzelltransplantation heilbar ist – dennoch kommt es bei vielen Patient:innen zu Rückfällen. Diese Rückfälle sind die häufigste Todesursache nach Transplantation, ihre genauen Ursachen sind bislang unzureichend verstanden. „Mit unserem Projekt möchten wir nun herausfinden, ob die Rückfallmechanismen je nach Risikoprofil der Erkrankung unterschiedlich sind“, erläutert Prof. Dr. Katharina Fleischhauer vom Institut für Zelltherapeutische Forschung der Universitätsmedizin Essen. Dazu werden moderne Einzelzellanalysen an Knochenmarksproben von Patient:innen durchgeführt, die nach einer Transplantation einen Rückfall erlitten haben. Ziel ist es, charakteristische Veränderungen in Krebs- und Immunzellen zu identifizieren, die neue, gezielte Therapieansätze ermöglichen könnten. Das Projekt bringt Expert:innen aus Hämatologie, Bioinformatik und Genetik zusammen und nutzt neueste Technologien. Langfristig soll so die Behandlung von AML-Rückfällen individuell angepasst und wirksamer werden.
Personalisierte Krebstherapie: Blasentumoren im Mini-Format testen und gezielt behandeln
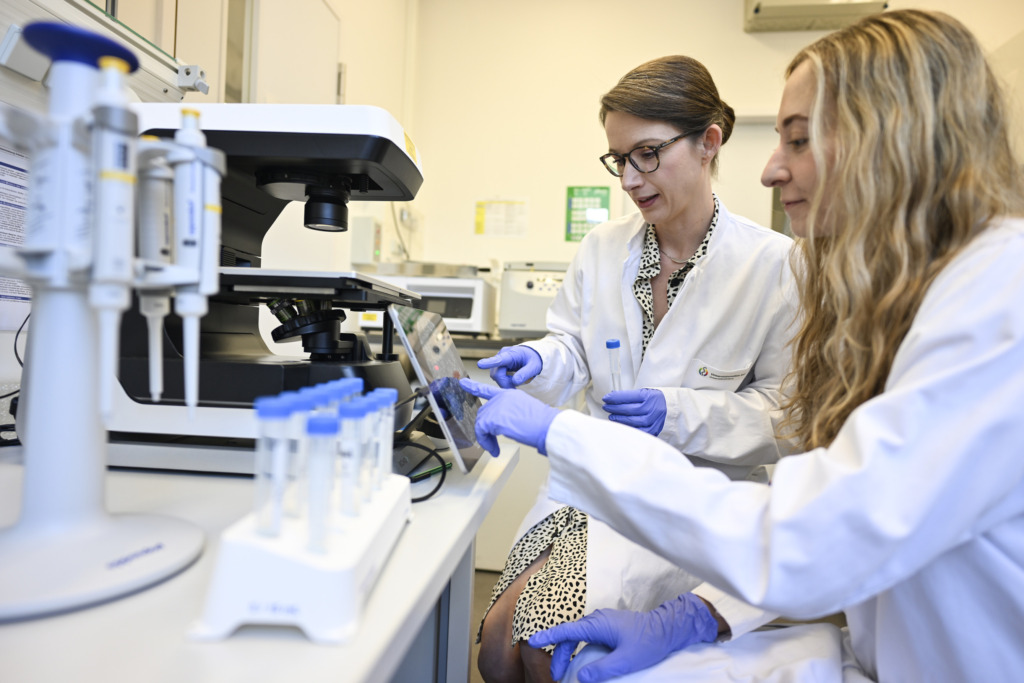
Blasenkrebs, insbesondere in fortgeschrittenen Stadien, ist schwer zu behandeln und geht oft mit einer schlechten Prognose einher. Immuntherapien zeigen nur bei einem Teil der Patient:innen Wirkung – bisher fehlt ein zuverlässiger Weg, um vorherzusagen, wer darauf anspricht. „Mit unserem Projekt möchten wir eine neue Testplattform entwickeln“, erklärt Prof. Dr. Barbara Grünwald von der Klinik für Urologie der Universitätsmedizin Essen. Dazu dienen sogenannte „Patient-derived tumor fragments“ (PDTFs) – also kleine Tumorgewebestücke, die außerhalb des Körpers kultiviert werden und die individuelle Immunreaktion nachbilden. Diese Methode wurde bereits erfolgreich bei anderen Krebsarten eingesetzt, aber noch nicht für Blasenkrebs angepasst. In drei Schritten soll die Methode nun etabliert, die Reaktion von Immunzellen analysiert und die Wirksamkeit moderner Therapiekombinationen getestet werden. Langfristig soll so eine personalisierte Therapieplanung möglich werden, die gezielt wirksame Behandlungen auswählt. Die Plattform könnte später auch auf andere Tumorarten übertragen werden und hat großes Potenzial für eine individualisierte Krebsmedizin.
Langzeitfolgen verstehen: Neue Wege zur frühzeitigen Erkennung einer Abstoßungsreaktion nach Transplantation
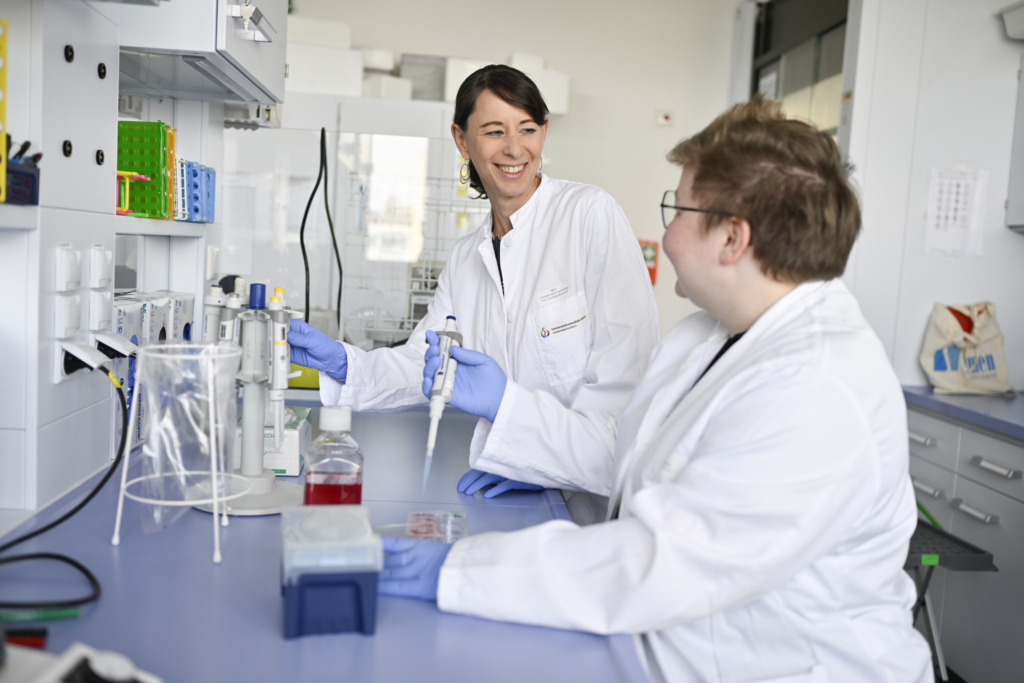
Nach einer Lungentransplantation entwickeln viele Patient:innen langfristig Komplikationen, die ihre Lungenfunktion wieder stark einschränken – diese werden unter dem Begriff „chronische Lungenallograft-Dysfunktion“ (CLAD) zusammengefasst. Die Erkrankung wird in zwei Hauptformen unterteilt: das BOS (mit Verengung der Atemwege) und das RAS (mit Versteifung des Lungengewebes), beide sind schwer zu behandeln. „Unser Forschungsprojekt untersucht, wie Zellen aus der Lunge – insbesondere die Epithelzellen der Atemwege – an der Entstehung dieser Komplikationen beteiligt sind“, erklärt Prof. Dr. Michaela Schedel-Bockholt von der Arbeitsgruppe Translationale Pneumologie der Universitätsmedizin Essen und der Ruhrlandklinik. Dafür werden Zellen von Spendern und Empfängern vor und nach einer Lungentransplantation regelmäßig untersucht und mit verschiedenen modernen Methoden analysiert. Ziel ist es, frühzeitig Warnzeichen für CLAD zu erkennen und sogenannte Biomarker zu finden, mit denen man das Risiko besser einschätzen kann. Langfristig sollen dadurch neue, gezieltere Therapien entwickelt werden, die individuell angepasst sind. Das Projekt nutzt dazu moderne Zellkulturmodelle und verknüpft klinische Praxis mit Grundlagenforschung, um das Verständnis der Abstoßungsprozesse zu verbessern.